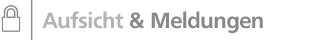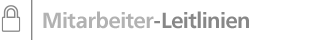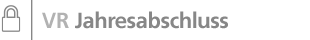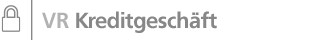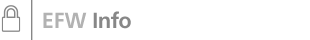Mit der Baseler Eigenkapitalvereinbarung von Juni 2004, bekannt als Basel II, wurden die Anforderungen an das Eigenkapital von Kreditinstituten stärker an das Risiko einzelner Geschäfte gekoppelt. Die Europäische Union setzte diese Vorgaben mit der Richtlinie 2006/48/EG (CRD II) um. Damit erhielten Banken erstmals die Möglichkeit, gängige Sicherheiten auch aufsichtsrechtlich zur Reduzierung des Eigenkapitals einzusetzen.
Welche Sicherheiten dabei berücksichtigt werden, hängt vom gewählten Ansatz zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen ab. Zulässig sind etwa finanzielle Sicherheiten, Garantien, Kreditderivate, Nettingvereinbarungen sowie bestimmte Sachsicherheiten und Immobilien. Voraussetzung ist stets, dass die jeweilige Technik zur Kreditrisikominderung den aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen genügt.
Kreditrisikominderung nach der CRR
Die ursprünglich in der CRD II geregelten Vorschriften zur Anerkennung und Berechnung von Kreditrisikominderungen wurden 2013 mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR I) in unmittelbar geltendes EU-Recht überführt. Die Überarbeitung durch die CRR II im Jahr 2019 brachte in diesem Bereich keine wesentlichen Änderungen.
Nach Artikel 4 Absatz 1 Nr. 57 CRR bezeichnet Kreditrisikominderung jedes Verfahren, mit dem ein Institut das Risiko seiner Positionen verringert. Die CRR unterscheidet zwischen „Besicherungen mit Sicherheitsleistung“ und „Absicherungen ohne Sicherheitsleistung“. Während im ersten Fall Vermögenswerte oder Beträge als Sicherheit dienen, übernimmt im zweiten Fall ein Dritter die Zahlung im Ausfall des Kreditnehmers — etwa über Garantien, Bürgschaften oder Kreditderivate.
Sie interessieren sich für das Thema Kreditsicherung? Ein vollständiges Dossier sowie viele weitere Werke finden Sie in unserem Modul BVR Bankenreihe. Dort bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand.
Der europäische Gesetzgeber will, dass nationale, in der Bankenpraxis übliche Sicherheiten – soweit möglich – aufsichtlich anerkannt werden. Daher umfasst der Begriff Garantie beispielsweise auch Bürgschaften oder Patronatserklärungen, wenn sie im jeweiligen nationalen Recht vergleichbar wirken.
Welche Wirkung eine Kreditrisikominderung entfaltet, hängt von ihrer Art und der angewendeten Methode ab. Im Standardansatz gilt häufig das Substitutionsprinzip, das das Risikogewicht durch die Qualität der Sicherheit ersetzt. Bei der umfassenden Methode wird der Marktwert der Sicherheit um sogenannte Haircuts vermindert, die Wert- und Währungsschwankungen abbilden. Im internen Ansatz (IRBA) erfolgt die Anrechnung über eine Anpassung der Verlustquote bei Ausfall (LGD).
Zudem verpflichtet Artikel 453 CRR die Institute, ihre Techniken zur Kreditrisikominderung in den Offenlegungsberichten transparent darzustellen.
Besonderheiten im genossenschaftlichen Bankensektor
Die genossenschaftlichen Institute in Deutschland sind überwiegend kleine und mittlere Regionalbanken. Ihr Geschäftsmodell ist konservativ und kundenorientiert. Der Schwerpunkt liegt im Kreditgeschäft, weshalb das Management von Kreditrisiken besondere Bedeutung hat. Grundlage jeder Kreditentscheidung sind Bonität und Tragfähigkeit des Kunden, bewertet durch angepasste Ratingverfahren.
Fast alle Genossenschaftsbanken nutzen den Standardansatz zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen. Dieses Verfahren ist weniger komplex, erlaubt aber nur eine begrenzte Zahl aufsichtlich anerkannter Sicherheiten. Häufig genutzte Sicherheiten wie Forderungsabtretungen, Immobilien oder Sachsicherheiten setzen den internen Ratingansatz (IRBA) voraus. Da dieser im genossenschaftlichen Bereich kaum Anwendung findet, können solche Sicherheiten aufsichtsrechtlich nicht angerechnet werden.
-
Sie wollen den vollständigen Artikel lesen? Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem Werk “Kreditsicherung nach der CRR” von Dr. Olaf Achtelik, Thorsten Reinicke und wurde von Ares Abasi für journalistische Zwecke aufbereitet. Alle Informationen zum Werk lesen Sie hier.