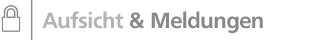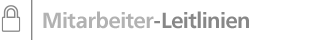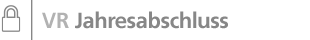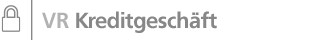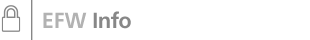Bild: : KI-generiert
Vom Pariser Klimaabkommen bis zur EU-Taxonomie: Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen treiben den Wandel im Finanzsektor voran?
Pariser Klimaabkommen: Die Grundlage des Green Deals
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichteten sich 2015 197 Unterzeichner-Staaten, den Klimawandel einzudämmen. Sie wollen gemeinsam daran arbeiten, den weltweiten Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius, aber unbedingt auf unter zwei Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen.
Dabei legen die Staaten grundsätzlich selbst fest, welche Maßnahmen sie ergreifen, um dieses Klimaziel zu erreichen. Bis 2020 mussten alle Länder langfristige Strategien für eine treibhausgasarme Entwicklung vorlegen. Alle fünf Jahre, beginnend 2018, gibt es eine globale Bestandsaufnahme, um zu prüfen, ob die Unterzeichner auf dem richtigen Weg sind. Ab 2025 müssen die Staaten ihre Klimaschutzbeiträge alle fünf Jahre aktualisieren und erhöhen.
Europäischer Green Deal: Wie will Europa klimaneutral werden?
Der Green Deal ist die europäische Antwort auf die Verpflichtungen, die sich aus dem Pariser Abkommen ergeben. Mit dem Green Deal beschlossen 2019 die 27 EU-Mitgliedstaaten, klimaneutral zu werden. Konkret wollen sie:
- Klimaneutralität bis 2050: Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden.
- Emissionen senken: Reduzierung der Emissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990. Drei Millionen zusätzliche Bäume bis 2030
- Wirtschaft umgestalten: Entwicklung eines neuen, nachhaltigen Wirtschaftsmodells mit Fokus auf Innovation und grüne Arbeitsplätze
- nachhaltigen Verkehr: Einführung emissionsfreier Neuwagen bis 2035 und signifikante Senkung der Emissionen im Verkehrssektor
- sauberes Energiesystem: Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf mindestens 42,5 Prozent bis 2030; Verbesserung der Energieeffizienz um 11,7 Prozent bis 2030
- Gebäude sanieren: Verdopplung der Sanierungsquote zur Verbesserung der Energieeffizienz und Bekämpfung von Energiearmut
- Natur- und Gesundheitsschutz: Förderung der biologischen Vielfalt und Wiederherstellung der Natur zur CO2-Speicherung
- globale Klimaschutzmaßnahmen: Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Bekämpfung des Klimawandels und Förderung erneuerbarer Technologien weltweit
Taxonomie: Welche Klimaziele verfolgt die EU?
Infolge des Green Deals trat 2020 die EU-Taxonomie in Kraft, die europaweit definiert, was wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig ist. Um die Klima- und Energieziele der EU zu erreichen, ist es dringend notwendig, Kapitalmarktströme in nachhaltige Projekte umzulenken. Die Taxonomie dient dazu, Finanzmarktteilnehmern Sicherheit zu geben, dass sie tatsächlich in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten investieren. Sie soll verhindern, dass Anbieter von Finanzprodukten diese als nachhaltig vermarkten, obwohl sie es nicht sind – das sogenannte Greenwashing.
Das sind die konkreten Bewertungsmaßstäbe der Taxonomie:
- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen
- Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft
- Vermeidung von Verschmutzung
- Schutz von Ökosystemen und Biodiversität
Wen betrifft die EU-Taxonomie?
In Deutschland müssen bestimmte Unternehmen jährlich über ihre Nachhaltigkeitsstrategien berichten. Diese Pflicht ergibt sich aus dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG), das die europäische Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung (NFRD) in nationales Recht umwandelt. Das Gesetz fördert die Transparenz in wichtigen Bereichen wie Umweltschutz, sozialen Belangen und Unternehmensführung (ESG). Betroffen sind:
Unternehmen von öffentlichem Interesse, die vom CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) oder zukünftig von der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) betroffen sind, sowie Finanzmarktteilnehmer, die der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) unterliegen.
Kapitalgesellschaften, haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften und Genossenschaften, wenn sie:
- als groß eingestuft werden (§ 267 Abs. 3 Satz 1 HGB),
- kapitalmarktorientiert sind (§ 264d HGB) und
- im Jahresdurchschnitt mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigen.
Kreditinstitute (§ 340a HGB) und Versicherungen (§ 341a HGB), wenn sie die Kriterien 1 und 3 erfüllen.
Mutterunternehmen, wenn sie mindestens zwei dieser Kriterien erfüllen:
- kapitalmarktorientiert sind,
- die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen nicht von der größenabhängigen Befreiung profitieren und
- insgesamt über mehr als 500 Beschäftigte verfügen.
Mutterunternehmen, die Kreditinstitute (§ 340i Abs. 5 HGB) oder Versicherungen (§ 341j Abs. 4 HGB) sind, müssen berichten, wenn sie die Kriterien für Kapitalmarktorientierung und Beschäftigtenzahl erfüllen. Für berichtspflichtige Tochterunternehmen gelten Befreiungsvorschriften, wenn sie in nichtfinanzielle Konzernerklärungen oder Konzernberichte einbezogen sind (§ 289b Abs. 2 und 3 HGB; § 315b Abs. 2 und 3 HGB).
Die Berichtspflichten gelten seit dem Berichtsjahr 2017 und das CSR-RUG wird voraussichtlich im Sommer 2024 durch die CSRD ersetzt.
So funktioniert die Taxonomie (am Beispiel „Klimaschutz“):
Für dieses Ziel gibt es die konkretesten Vorschläge. Ein Unternehmen kann auf drei Arten einen wichtigen Beitrag zum ersten Umweltziel leisten, wenn:
- es selbst sehr geringe oder keine Treibhausgasemissionen verursacht, wie etwa bei Aufforstungen,
- es den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 unterstützt und es keine sogenannte tiefgrüne Alternative gibt. Ein Beispiel sind Zementproduktionsverfahren, die weniger als 0,498 Tonnen CO2 pro Tonne Zement ausstoßen. Viele europäische Wirtschaftsaktivitäten fallen in diese Kategorie,
- es andere Wirtschaftsaktivitäten beim Umweltschutz unterstützt, wie die Herstellung bestimmter Komponenten, die die Umweltbilanz der Nutzer verbessern. Ein Beispiel ist die Produktion von Windkrafträdern, die emissionsarmen „grünen“ Strom ermöglichen.
Auswirkungen der Taxonomie
Die weitreichenden Konsequenzen der Taxonomie sind noch schwer abzuschätzen. Diese möglichen Auswirkungen sollte man jedoch im Blick behalten:
- Unternehmensfinanzierung: Der Nachweis nachhaltiger Umsätze führt zu mehr Investitionen.
- Bessere Finanzierungsbedingungen: Nachhaltige Unternehmen erhalten leichter Kapital.
- Marktakzeptanz: Der Erfolg der Taxonomie hängt vom Finanzierungsumfeld ab.
- EU-Standards: Einheitliche Kennzeichen für nachhaltige Finanzprodukte werden entwickelt.
- Reputation: Transparente Angaben stärken Vertrauen; mangelnde Offenheit kann schädlich sein.
- Kaufentscheidungen: Nachhaltigkeit wird für Verbraucher zunehmend wichtig.
- Zahlungsbereitschaft: Verbraucher zeigen oft eine begrenzte Zahlungsbereitschaft für umweltfreundliche Produkte.
- Umsatzpotenzial: Studien prognostizieren Umsatzpotenzial von 10 Billionen Euro bis 2050 im deutschen Maschinen- und Anlagebau durch klimaschonende Technologien.
- Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung: Taxonomie kann Treiber für die Agenda 2030 und die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie werden.
Ein Text von Ares Abasi